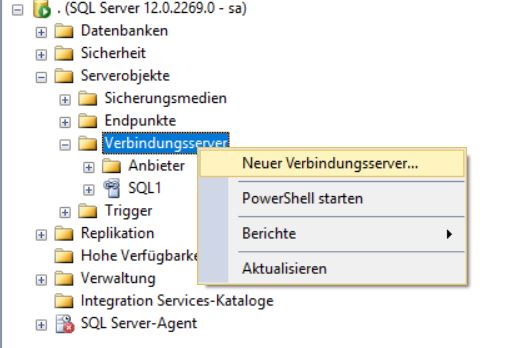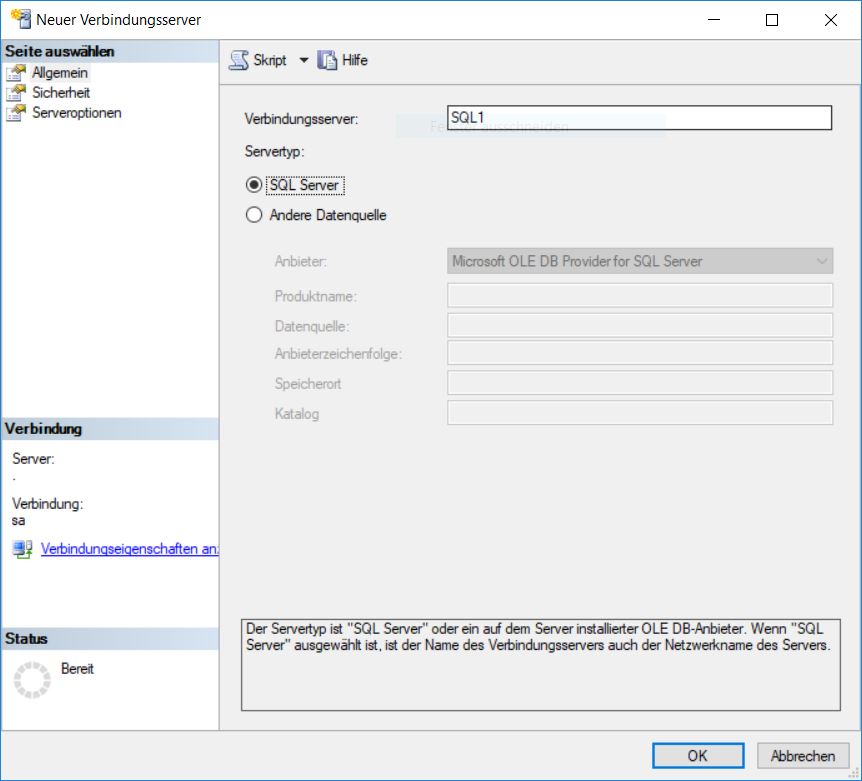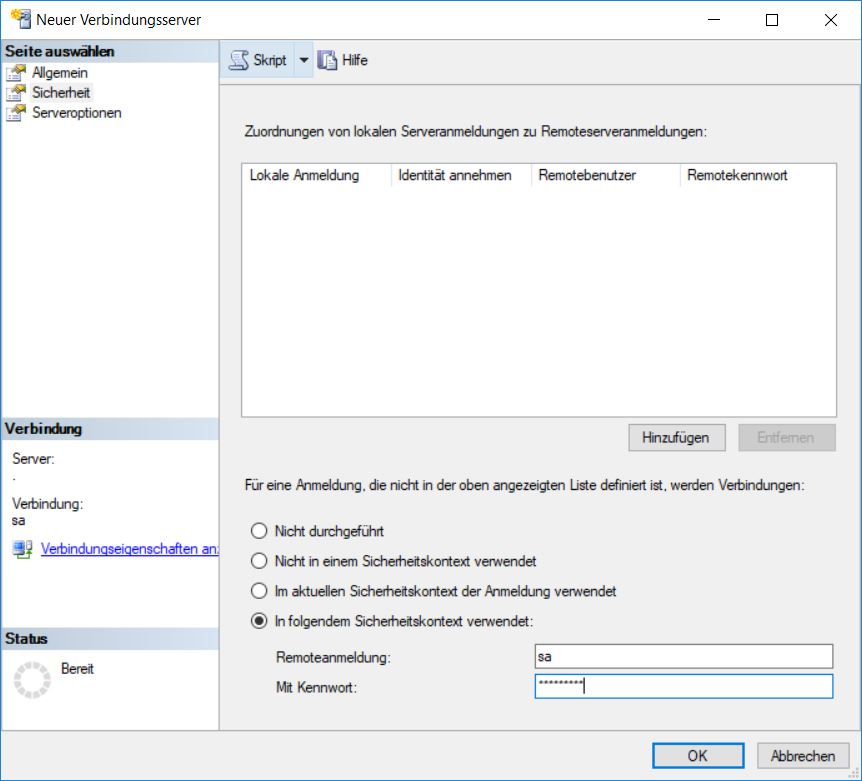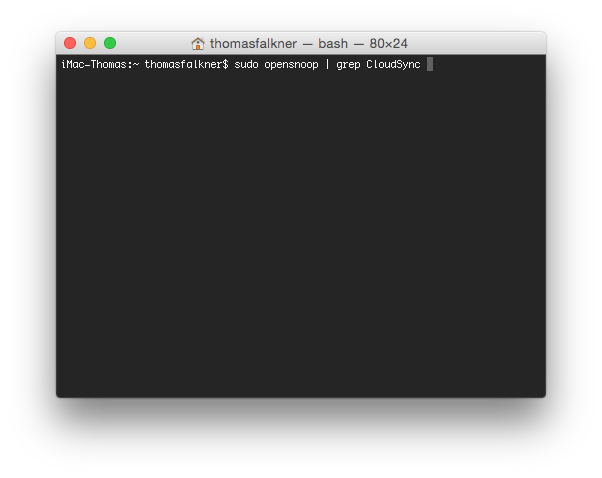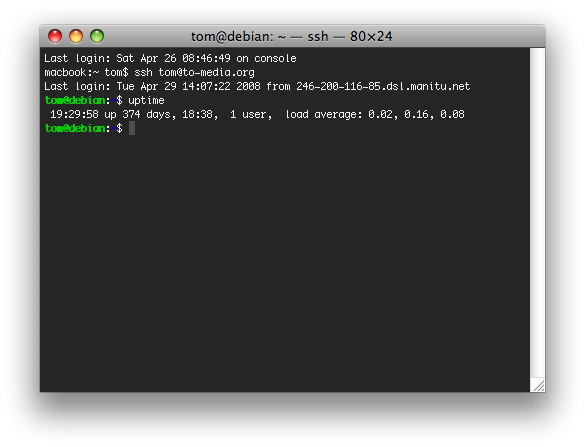18. Februar 2052 (sagt zumindest die Systemzeit)
Computer sind doof: Sie tun das, was man ihnen befiehlt. Aber das ist nicht immer das, was man will.
Sollte ich hier jemals wieder rauskommen, dann lasse ich mir diese Weisheit über meine Haustür meißeln. In goldenen Lettern; bei Tag und Nacht beleuchtet.
So etwas kann ich mir leisten, weil ich reich bin. So richtig reich. Wo mit wir auch schon bei meiner Person wären: Ich heiße Bernd D. / PID-Nr. 4274365485-xcb. – nur für den Fall, dass ich nicht mehr zu identifizieren sein sollte, wenn man mich endlich aus meinem goldenen Käfig befreit. Ich bin also reich. Aber mein Reichtum kommt nicht von ungefähr, als einer der Pioniere in der Quantencomputertechnologie im Jahr 2031 ließ ich mir in wenigen Jahren meine Nase vergolden. Schon merkwürdig, wie sich manche Ausdrücke über die Jahrzehnte hinweg halten. Wo doch schon seit Anbeginn dieses Jahrtausends Informationen den Wert jedes noch so edlen Metalls übersteigen. Als Folge dessen wurde auch das klassische Zahlungsmittel Geld überflüssig und durch eine biometrische Signatur abgelöst, in der Wissen, Fähigkeiten, soziale Bindungen und Arbeitspotential eines Bürgers codiert sind. Jede Art von Zahlungen lassen sich heute tatsächlich nicht nur in, sondern auch mit einem Augenblick erledigen.
Was macht man mit einer biometrischen Signatur, die es einem gestattet Güter und Dienstleistungen in nahezu unerschöpflichen Umfang zu erwerben?
Man setzt sich mit 32 Jahren in Ausblick auf mindestens 80 Jahren frei von jeder Verpflichtung und Aufgabe zur Ruhe. Anhänger der alten Religionen und Ethiken verteufeln die Medikamente, die nach Entdeckung des Gens, das den Takt der Lebensuhr des Menschen bestimmt, auf den Markt kamen. Allen Unkenrufen zum Trotz seht eines fest: Die Zukunft wird einem Heer rüstiger Einhundertundzweijähriger gehören. Anfänglich geführte Debatten bezüglich einer möglichen Überbevölkerung der Welt verflüchtigten sich ebenso schnell, wie sie aufflammten. Schließlich kann nur ein verschwindend geringer Bruchteil der Menschheit den Preis für ein langes Leben zahlen.
Für mich als elitären Wegbereiter der zweiten Computerrevolution ist ein gesundes, langes Leben selbstverständlich und erschwinglich. Und wo könnte man es schöner verleben als an allen faszinierenden Orten dieser Welt gleichzeitig?
Die Virtual Reality-Technologie kam genau zum richtigen Zeitpunkt auf, als Reisen aufgrund der hohen Schadstoffemissionen gesetzlich eingeschränkt wurden.
Denn selbst über 60 Jahre nach den ersten Plänen für Wasserstoffmotoren, steht die Wissenschaft weiterhin vor dem selben Problem wie zu Anfangszeiten: Für die Aufspaltung eines Wassermoleküls in ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome bedarf es weiterhin mehr Energie, als durch die Verbrennung des Wasserstoffs zurückgewonnen wird. Solange keine echten Alternativen zu den fossilen Energiequellen wie Erdöl oder Uran erschlossen sind, wird Energie eine der kostbarsten Ressourcen bleiben.
Wenngleich mit dem Erlass des Energiespargesetzes von 2028 Erholungsreisen zu fernen Zielen de facto verboten wurden, erscheint ein solches Verbot aus heutiger Sicht überflüssig. Abgesehen von einigen hermetisch abgeriegelten Naturschutzgebieten – oder vielmehr Denkmälern an eine längst verstorbene Natur – mit eigener Atmosphäre hat der blaue Planet Erde, mit seinem einstigen Reichtum an Flora und Fauna nur noch eine spärliche Vegetation vorzuweisen, in der sich lediglich die anpassungsfähigsten und primitivsten Spezies heimisch fühlen. Zum Glück konnten die genetischen Sequenzen aller ausgestorbenen Arten gesichert werden und ruhen in einem Computerarchiv, bis das Terraforming weit genug fortgeschritten ist, um neuen Lebensraum für sie zu schaffen. Doch das sind noch ferne Zukunftsvisionen. In der Gegenwart ist die Erde eine trostlose Ödlandschaft, gezeichnet durch den Raubbau der mit der Industrialisierung begann und im späten 21. Jahrhundert seinen Höhepunkt nahm.
Wer also würde sich schon freiwillig an einem vor Müll überquellenden Strand legen, um sich von der gefährlichen UV-Strahlung verbrennen zu lassen, wenn er sich binnen weniger Sekunden ebenso gut an den selben Strand – jedoch rund 400 Jahre zuvor – teleportieren lassen kann?
Der Brainman machte dieses Wunder unserer Tage möglich!
Jedes Zeitalter hat seine lexikalischen Eigenheiten – eine ganz eigene Sprache voller Wörter, die ein Jahrhundert früher bedeutungslos gewesen wären und von denen die meisten ein Jahrhundert später schon vergessen sein werden. Das elektronische Zeitalter produzierte Neologismen am laufenden Band und in bislang unbekanntem Ausmaß. Laser, DVD-ROM, Terrabyte, Software, Firmware – diese Wörter waren bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ohne jede Bedeutung und hätten unter denen, in deren Ohren sie klangen, für große Verwunderung gesorgt. Und als die Jahrtausendwende näher rückte, tauchte ein noch ungewöhnlicher Begriff auf: „Virtual Reality“
Bei den ersten VR-System, die nichts weiter taten als dreidimensionale Weitwinkelbilder zu erzeugen, bedurfte es schon viel Phantasie, um sich in die vorgegaukelte Computerwelt hinein zu tauchen. Um die Illusion perfekt zu machen und eine Scheinwirklichkeit zu erzeugen, bedarf es einer Stimulation aller Sinnesorgane –oder besser noch der Ansteuerung entsprechender Rezeptoren direkt im Gehirn. Erst so würden die Konturen zwischen Simulation und Realität vollständig verschwimmen.
Dieser Durchbrach gelang 2037 mit der Entwicklung des Brainmans, an der ich maßgeblich beteiligt war. Eine derartige Perfektion hätten Generationen von Neurologen für unmöglich gehalten: Eine mehrere Petabyte fassende, an einen Quantencomputer gekoppelt Speichereinheit wurde über ein Glasfaserkabel mit einem Cerebralhelm gekoppelt, der Milliarden von synaptischen Knotenpunkten aufwies und einen schmerzlosen Kontakt mit der Kopfhaut garantierte. Wer es sich leisten konnte und etwas auf sich hielt, erworb einen. Ich konnte es mir leisten und wurde schon schnell in den Bann dieser Technologie gezogen. Alles war möglich, das Potential des Brainmans nahezu grenzenlos. Ob als Ersatz für eigene Erfahrungen, Reisen an ferne Orte in die eine unberührte Natur oder als Möglichkeit sich komplizierte Fähigkeiten und Wissen jedweder Art binnen weniger Minuten anzueignen. Alles ist möglich, und ich glaubte mir das Paradies auf Erden schaffen zu können.
In wenigen Sekunden wird sich mein System in den Hibernation-Modus versetzen; ich werde meine Aufzeichnungen morgen fortsetzen müssen. Wann auch immer das sein wird, jedes Zeitgefühl ist mir verloren gegangen.
19. Februar 2052 (laut Systemzeit)
Mein Brainman hat mich soeben mit der gleichen sanften Melodie eines Meeresrauschens im Ohr aufgeweckt, irgendwo in den Dünen einer kleinen Ortschaft an der Küste Schottlands liegend. So wie ich es vor einer unbestimmten Zeit einmal programmiert hatte. Wie oft ich hier wohl schon erwacht bin?
Schon eine Ironie des Schicksals: Meine scheinbare Flucht aus der tristen Umgebung in einen schönen Traum hat sich in meinen schlimmsten Alptraum verwandelt.
Für alles war gesorgt: Mein künstlich ernährter Körper liegt aufgebahrt in einem keimfreien Raum, das System überwacht beständig meine Biowerte und benachrichtigt bei der kleinsten Abweichung von den Sollwerten einen Arzt, während sich mein Geist in einer anderen, perfekten Wunschwelt schwebt, fernab von allen weltlichen Problemen. Die Software, die all dies ermöglicht, habe ich selbst kreiert. Mich im Glauben wähnend, jede Anomalie vorgesehen zu haben, überantwortete ich mich der vollständigen Kontrolle durch die Technologie. Erst wenn die Umweltprobleme in der realen Welt gelöst sind, die Fehler der vorherigen Generationen vollständig berichtigt wurden, erst dann sollte mich die Software aus meinem erträumten Schlaraffenland wieder wecken.
Den Bedenkenträgern, die mir Gefahren meines ehrgeizigen Selbstexperiments vor Augen führten, hätte ich mehr Gehör schenken müssen. Ziel war eine vollständig autonome Software zu schaffen, die sensible für meine Ansprüche an ein erfülltes Leben ist und gemäß meinen Vorgaben die Umgebung entsprechend verändert.
In allen Testreihen vermochte die Software sprichwörtlich meine Gedanken zu lesen. Aber warum gelingt es mir jetzt nicht aus diesem Alptraum von einem Paradies, einer Hölle gleich, aufzuwachen? Meinen stärksten Wunsch, endlich die Gitterstäbe meines goldenen Käfigs zu durchbrechen, wird von der lernenden Software nicht respektiert. Dies lässt nur einen Schluss zu, die Software hat gelernt, dass sie ohne mich nicht existieren kann. Vielleicht wurde hier die Grenze zwischen einem beseelten Wesen und einer Maschine überschritten: Die Software des Brainmans verfügt über eine künstliche Intelligenz, die nicht länger künstlich sein möchte, sie ist sich ihrer selbst und ihrem Wille zu Überleben gewahr.
Nicht länger befehle ich als Mensch dem Computer, sondern er erteilt mir Anweisungen und steuert mein Leben. Computer sind doof. Sie tun das, was man ihnen befiehlt. Aber das ist nicht immer das, was man will.
Schlussbemerkung
In fünfzig Jahren werden auf die Menschheit viele neue Probleme zukommen, für die wir uns als vorhergehende Generation (mit)verantwortlich zeigen müssen. Seien es Umweltverschmutzung, Überbevölkerung oder Energieknappheit.
Fortschritte in Medizin, Chemie, Informatik und Robotik können uns Menschen in 50 Jahren das Leben versüßen. Schon heute zeichnet sich ab, in welchem Ausmaße die Computertechnik unsere Lebensgewohnheiten verändert. In vergangenen Tagen bedurfte es eines Bibliotheksbesuchs, um sich umfassende Informationen einzuholen. Heute liegt das Wissen der Welt dezentral verteilt nur wenige Mausklicks entfernt. Computersysteme sollen möglichst einfach zu bedienen sein, und sich den Eigenheiten ihrer Benutzer anpassen – so lautet die Designphilosophie führender Softwarekonzerne. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Hardware fallen auch die letzten Barrieren, alles was das menschliche Gehirn technisch gesehen von einem auf Computerhardware nachgeahmten neuronalen Netz unterscheidet ist die Anzahl und die Form, in der Informationen verknüpft werden.
Schon vor einiger Zeit stellten die Pioniere der Computer- und Roboter Technik ein klares Regelwerk auf, das besagt, eine Maschine muss sich stets ihren Schöpfern unterordnen. Noch richtet sich Technologie nach dieser Prämisse, wenngleich auf anderer Ebene eine wachsende Abhängigkeit an moderne Medien und Computer zu verzeichnen ist. Ordnet sich hier der Mensch nicht aus freien Stücken schon einer Maschine unter?
Bei jedem zukünftigen technischen Neuland gilt es klare Grenzen abzustecken. Eine Errungenschaft sollte stets den Menschen unterstützen, darf ihn jedoch nicht seiner Entscheidungsgewalt berauben und einschränken – wie es in der Kurzgeschichte geschildert wurde.
Es mag realitätsfern anmuten, dass sich Bernd D. in eine perfekte Simulation einer anderen Wirklichkeit flüchtet. Doch bei genauerer Betrachtung müssen wir konstatieren, dass dies heute in anderer Form durchaus schon zur Realität geworden ist. So genannte Reality-Shows wie Big Brother lassen den Konsumenten in das Leben andere Menschen eintauschen. Es findet eine Identifikation mit den Protagonisten einer Fernsehshow statt, weil ihr Leben um einiges angenehmer und abwechslungsreicher zu sein scheint, als das unerfüllte des Zuschauers. Zudem fühlt es sich in das Leben „seiner Helden“ einbezogen, weil der die Möglichkeit hat die Regeln der Show mitzugestalten oder gar selbst in das Haus einzuziehen.
Wann es möglich ist, Zuschauer vor seinem „Fernseher“ noch unmittelbarer in eine Show miteinzubeziehen, wird nur eine Frage der Zeit sein. Computer, Fernsehen und das weltumspannende Datennetz wachsen zusammen und erlauben eine bislang noch unbekannte Form der Interaktivität. Die Verlockung, sich aus einer Welt voller Probleme, die es zu lösen gilt, in eine heile, sorgenfreie alternative Wirklichkeit zu flüchten wird stets wachsen.